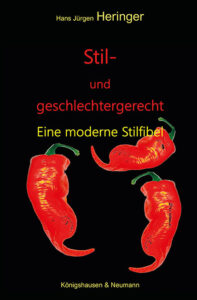Für visuellen Journalismus habe ich mich schon am Anfang meiner Laufbahn interessiert und dazu 1977 einen Aufsatz veröffentlicht.
Ballstaedt, Steffen-Peter (1977). Grenzen und Möglichkeiten des Filmjournalismus in der aktuellen Berichterstattung. Rundfunk und Fernsehen, 25, S. 213-229.
Ein kritischer Punkt darin war die Augenzeugenillusion: Mit einem Pressefoto zeigt ein Fotografen einen Ausschnitt der Wirklichkeit in bestimmter Perspektive und Schärfentiefe. Er legt fest, was man sieht und was man nicht sehen kann. Er konserviert und vermittelt seine Wahrnehmung. Ein Foto ist bereits ein Kommunikat, eine visuelle Erfahrung aus zweiter Hand.
Einen Schritt weiter gehen zielgerichtet manipulierte Fotos, anfangs nur Retuschen, mit denen aber auch schon erhebliche Veränderungen möglich waren: Personen konnten z.B. aus einem Foto entfernt oder Gegenstände hineingestellt werden. Die Bildbearbeitungsprogramme wie z.B. Fotoshop bieten dann eine große Palette an Möglichkeiten, ein aufgenommenes Bild nachträglich zu gestalten. Seriöse Zeitungen markieren ein bearbeitetes Bild mit [M].
Und jetzt können Fotos mittels sprachlichen Eingaben (Prompts) mit KI- Bildgeneratoren generiert werden. Im Netz kursieren täuschend echt wirkende Bilder. Bekannt geworden ist der Papst mit modischer weißer Daunenjacke. Bei der Lage der Katholischen Kirche muss ich der Papst zwar warm anziehen, aber genau hinschauende Spezialisten können Fehler erkennen. Unbedarfte Betrachtende sehen sie nicht auf den ersten Blick.
Und eine weitere Steigerung sind gefakte Videos. Damit lassen sich witzige Botschaften verbreiten, aber auch Lügen und politische Manipulationen. Bewegten Bildern vertraut man noch am ehesten, auch wenn heutige Mediennutzer an special Effects und virtual Realities in Filmen gewohnt sind. Der oder die Mediennutzende kann eine abgebildete Wirklichkeit aber nur noch schwer von einer manipulierten oder generierten Realität unterscheiden. Und jetzt wird es bedrohlich, ja gefährlich, denn diese Medieninhalte lassen sich bewusst zur Desinformation einsetzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Man kann den eigenen Augen nicht mehr trauen. (01.01.2024)

Diesen Schnappschuss habe ich von einem Weihnachtstripp in den Gaza-Streifen mitgebracht. Quelle: Craiyon.