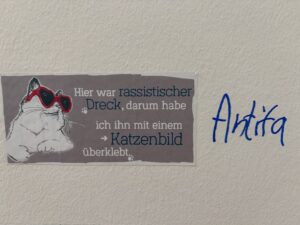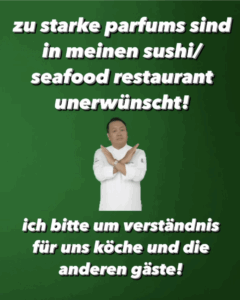Warum ein Roman den Deutschen Buchpreis bekommt, ist für einen dem Literaturbetrieb außenstehenden Lesenden oft nicht nachvollziehbar. 2025 wurde als bester Roman „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger ausgezeichnet. Aus der Begründung der Jury: „Dieser Roman ist ein Ereignis…ein faszinierender Trip ins Herz der Finsternis“, ein diskreter Verweis auf den Roman von Josef Conrad.
Ausgangspunkt ist das Verschwinden zweier Studierender im Dschungel Panamas, deren Schicksal ungeklärt ist. Die Autorin interessiert sich auch nicht für die Vermissten, der Roman beschreibt das Projekt eines Theatermachers (Werner Herzog, Christoph Schliengensief, Milo Rau?), der den Fall rekonstruieren möchte, indem er den Weg der beiden Frauen in den Dschungel nachvollzieht. Es geht dabei weniger um die Sicherung von Fakten, die sind bekannt, sondern um Nacherleben der Situation der beiden Frauen, sozusagen eine stellvertretende Psychoanalyse. In seiner Crew nimmt er auch eine Autorin mit, sie soll die Aktion protokollieren und gerät dabei in eine existentielle Krise und eine Schreibkrise. Darüber erzählt sie in einigen Vorträgen. Das bildet die Rahmenhandlung des Romans, in die viele weitere Geschichten eingebettet sind.
Ein verschachtelter Aufbau, aber wie ich finde, gut geschrieben. Die durchgängige indirekte Rede stört nicht, sondern lässt nie vergessen, dass wir es hier mit einem subjektiven Bericht zu tun haben.
Schon auf den ersten Seiten klingt eine Untergangsstimmung an: Die gegenwärtigen Verhältnisse sind „schlecht, ja tödlich“, „wenn alles so rasant auf sein unwiderrufliches Ende zuschlittere, erübrige sich der sinnhafte Text“ (S.10). In einem Interview spricht Elmiger von „existentieller Verlassenheit“ und „Grundlosigkeit unseres Daseins“, Damit wird ein existenzialistischer Ton angeschlagen, der den gesamten Roman grundiert.
Durch unzählige Adjektive erzeugt der Text eine trostlose Atmosphäre: düster, unruhig, dunkel, neblig, verhangen, unerträglich, verlassen, schmutzig, drückend, unheilvoll, fürchterlich usw.. Und die eingebetteten Geschichten berichten auch vom Scheitern. Wer positive Ansätze erwartet oder eine Lösung sucht, den wird der Text enttäuschen. Der Autorin wird im Urwald bewusst, „dass es hier keine Pointe geben, das die ganze Geschichte auf keine Auflösung, kein gutes Ende zu laufen würde.“ (S. 127). Nur in den letzten Sätzen des Romans öffnet sich plötzlich ein Portal, ein Spalt, sozusagen ein Hoffnungsschimmer. Diese abstrakte und inhaltsleere Andeutung ist für mich ein eher peinlicher Schluss, nachdem der Zustand der Welt und der Menschheit als apokaplyptisch beschrieben wurden.
Was den Lesefluss stört, ist das andauernde Name dropping, das nur geisteswissenschaftlich Versierte verstehen können. Horkheimer/Adorno haben die Autorin mit ihrer Dialektik der Aufklärung beeindruckt, nach der Wissen und Fortschritt in die Beherrschung der Natur (auch der Emotionen ins uns) umschlagen. Angeführt werden Ideen von Walter Benjamin, Siegfried Krakauer, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Didier Eribon. Als Literaten werden Ingeborg Bachmann, Robert Walser, Thomas Bernhard angeführt, manche Andeutungen muss man auch erschließen wie z.B. zu Peter Handke. Man bekommt den Eindruck, dass die Autorin beweisen möchte, wie belesen sie ist, statt ihre Botschaft in Erzählungen zu verpacken, was sie eigentlich gut kann. So wird die Lektüre zur intellektuellen Herausforderung.
Kritiker und Kritikerinnen haben den Roman sehr unterschiedlich besprochen. Die Bewertung des Textes ist sehr davon abhängig ist, ob man seine philosophischen Prämissen teilt. (03.12.2024)
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen. München: Carl Hanser, 2025, 158 Seiten.