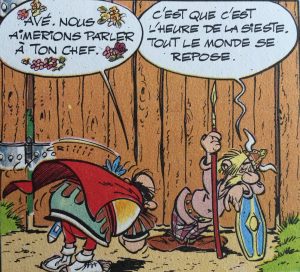GOOGLE hat es sich etwas kosten lassen und der letzten Ausgabe des SPIEGEL ein Heft beigelegt. Ausgangsthese: Wir hinterlassen durch alle Handlungen im Web wie Navigieren, Recherchieren, Buchen, Reservieren, Einkaufen, Kommunizieren, Streamen, Spielen, Bezahlen unsere Spuren, die zusammengefasst ein „digitales Ich“ oder eine „elektronische Identität“ bilden. Lassen wir einmal die Frage ausgeklammert, ob es so etwas wie ein Ich und eine Identität überhaupt gibt, sicher ist, dass unsere Hinterlassenschaften im Web etwas über uns aussagen, über Interessen, Bedürfnisse, Motive.
So wie wir ein soziales Ich in den Beziehungen mit anderen aufbauen, erhalten und verändern, so trägt auch digitale Kommunikation wie Mailen, Chatten, Bloggen, Fototausch zu unserem Ichgefühl bei. Hier sehe ich kein Problem. Etwas anders sind die Daten, die wir bei Netflix, Amazon, Facebook, Twitter, Google usw. ohne kommunikative Absicht hinterlassen. So lernt Netflix lernt mit jeder Serie, die wir anschauen oder auch nur den Trailer anklicken, mehr über unsere Vorlieben, ein Algorithmus berechnet daraus Empfehlungen und er ist lernfähig: Wer länger keine Erotikfilme mehr angeschaut hat, aber dafür Tierfilme, der bekommt zunehmend Tierfilme angeboten. (Kann man aus dieser Veränderung aber erschließen, dass sich seine erotische Bedürfnisse verändert haben?)
Was mich ärgert: Philosophische Konzepte wie „Ich“ und „Identität“ werden benutzt, um profitorientierte kommerzielle Interessen zu bemänteln. Diese Firmen interessieren sich nicht für Philosophie, sondern verdienen mit unseren Profilen bzw. errechneten Identitäten Geld. Sandra Matz, Assistant Professor of Management an der Columbia Business School in New beschäftigt sich als Computational Scientist mit Psychografischem Profiling: Wie lassen sich aus den Daten im Web Nutzerprofile für das Marketing erstellen. Aus den Likes bei Facebook werden z.B. introvertierte und extrovertierte Nutzer ermittelt, die dann personalisierte Werbung bekommen. Ihr Resümee: „Ich denke, die Menschen müssen begreifen, was Daten Positives herbeiführen und wie sehr wir alle durch die Analyse von Daten profitieren“
Die Beilage versucht, die Vorteile der Datenerhebung und -zusammenführung zu preisen und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen. GOOGLE stellt sein Safety Engeneering Center (GSEC) in München vor. Dort wirkt ein Privatsphäre-Team, das Datenschutz- und Sicherheitsprodukte entwickelt. Merkwürdig: Ein firmeneigene Abteilung, die gegen das eigene Geschäftsmodell arbeitet? (16.03.2020)