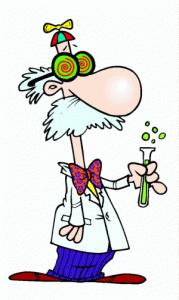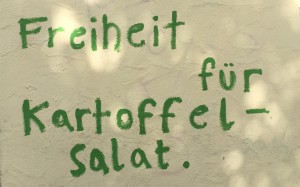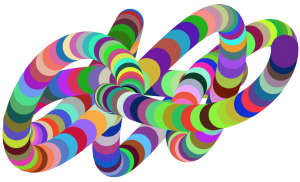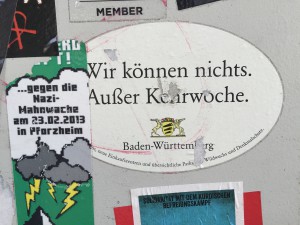Hans Jürgen Heringer/Rainer Wimmer (2015): Sprachkritik. Paderborn: Wilhelm Fink
Die ersten Kapitel des Buches sind für alle eine vergnügliche Lektüre, denen schon immer die Sprachkritiker und Sprachpfleger suspekt waren, die meist von hoher Warte gegen Wörter und Formulierungen zu Felde ziehen. Ihr methodisches Rüstzeug ist ein untrügliches Sprachgefühl, oft verbunden mit einem bildungsbürgerlichen Habitus, der auf „schlechten“ Sprachgebrauch, auf „Sprachdummheiten“ und „Sprachverhunzungen“ herabschaut.
Die Autoren machen deutlich, dass populäre Sprachkritiker wie z.B. Bert Schneider oder Bastian Sick sich nicht auf die Linguistik berufen können. Sie gehen von falschen Vorstellungen, von Sprachmythen aus: Die Sprache als Einheit, als Regelsystem, das festlegt, welche Wörter, Sätze und Redeweisen korrekt sind und welche nicht. Sie ignorieren, dass Sprache ständig im Wandel ist, es gibt keinen archimedischen Punkt, von dem aus man eine Sprache kritisieren könnte. Häufig wird die Metapher des sprachlichen Verfalls oder Niedergangs bemüht, die aber voraussetzt, dass es einen idealen Zustand der Sprache gegeben habe oder geben könnte.
Die Autoren wollen Sprachkritik linguistisch begründen und in der Kommunikation verankern. Dabei geht es nicht um die Beanstandung einzelne Wörter („Unwörter“ oder Anglizismen) oder Formulierungen (Beamtendeutsch, Wissenschaftssprache), sondern um das Denken und sprachliche Handeln in konkreten mündlichen und schriftlichen Kommunikationssituationen. Nicht eine Vokabel ist per se ist ein „Unwort“, sondern der Sprecher bzw. Schreiber gebraucht einen Ausdruck in unangemessener Weise. So kann ein Sprecher das Wort Zigeuner in abwertender Bedeutung verwenden, er muss es aber nicht, z.B. wenn er ein Zigeunerschnitzel bestellt. Wenn ein Sprecher allerdings weiß, dass Rezipienten das Wort abwertend verstehen, dann sollte er als kooperativer Sprecher auf das Wort verzichten. Es geht letztlich um unsere Kommunikationskultur. Vorbild ist ihnen hier Karl Kraus. Wie er, so finden sie auch bei Journalisten und Politikern die überzeugendsten Beispiele für unreflektierten bis manipulativen Sprachgebrauch. Sprache bildet Wirklichkeit ja nicht ab, sondern konstituiert auch eine Realität.
Ziel ist die Herausbildung einer sprachkritischen Kompetenz, ein reflektierter produktiver wie rezeptiver Sprachgebrauch, der auch in den Lehrplänen verankert und im Unterricht umgesetzt werden muss. Das ist ein Ansatz der Sprachkritik, der sich angenehm von den rechthaberischen und pedantischen Sprachpflegern abhebt. Das Buch ist natürlich eine Reaktion auf die verbreitete Ratgeberliteratur und die beliebten Sprachglossen, sie ist der Versuch der Sprachwissenschaft, dieses Terrain im Sinne einer „linguistischen Aufklärung“ zu besetzen.
Ein Problem wird dabei allerdings nur marginal angesprochen, obwohl es für einen derartigen Ansatz zentral ist. Es geht um Denken und Sprechen konkreter Sprecher oder Schreiber. Aber wie hängen Denken und Sprache zusammen? Produktiv: Drücken sich mentale Strukturen in Wortwahl und Satzkonstruktion aus? Rezeptiv: Kann man vom sprachlichen Ausdruck auf mentale Strukturen schließen? Ein schwieriges und heikles Thema, das auch den Einbezug der Psychologie fordern würde. Der gehen aber die Autoren geradezu paranoid aus dem Wege. Einmal werden empirische Untersuchungen angeführt (Kahneman/Tversky, S. 103), weil sie in die Argumentation passen, aber gleich mit einer Parenthese versehen, dass sie nichts erbracht habe, was Linguisten nicht ohnehin bereits denken (wobei Vermutungen wissenschaftlich ja nur Hypothesen sind, die empirisch überprüft werden müssen).
Ein zentrales Thema der Sprachkritik ist die Verständlichkeit, ihr sind zwei Unterkapitelchen (5.3 und 5.5) gewidmet. Dort lesen wir: „Verständlichkeitskritik läuft erst einmal ins Leere. Wer unverständlich redet, verfehlt sein Ziel. Kommuniziert wird ja, um sich verständlich zu machen“ (S. 99). Ist das so? Es gibt die intendierte Unverständlichkeit, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat, etwas verschleiern oder in bewusst in die Irre führen – und dabei Kompetenz und Expertise ausstrahlen möchte. Es ist richtig, dass Verständlichkeit kein einseitiges Merkmal eines Textes ist, sondern Merkmal einer Kommunikation zwischen Absender und Adressat. Aber das Thema wird doch sehr stiefmütterlich behandelt, wenn aus der psychologischen Forschung nur die verstaubte Flesch-Formel zu Messung der Verständlichkeit auf der Basis von Satzlänge und Wortlänge vorgeführt wird. Da ist man in der Sprachpsychologie bzw. Psycholinguistik doch weiter: Aus zahlreichen Experimenten weiß man, welche Wörter oder Satzkonstruktionen mehr kognitive Verarbeitung erfordern und daher in Häufung einen Text schwierig machen, auch wenn die einen Adressaten damit besser umgehen können als die anderen. Zum reflektierten Sprachgebrauch gehört auch, sich bewusst zu sein, welche unnötigen Erschwernisse man einem Rezipienten durch Wortwahl oder Satzkonstruktion abverlangt. Adressatenorientiertes Sprechen und vor allem Schreiben gehört sicher zu der angestrebten Sprachkompetenz.
Insgesamt ein überaus anregendes und notwendiges Buch. Die didaktischen Absichten werden in weiterführenden Aufgaben umgesetzt, diese sind anspruchsvoll, nicht die in Lehrbüchern üblichen Abfrage- oder Grübelaufgaben. Für ein Studienbuch ist es allerdings ein Ärgernis, dass zahlreiche zitierte Autoren im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt sind. (31.07.2015)